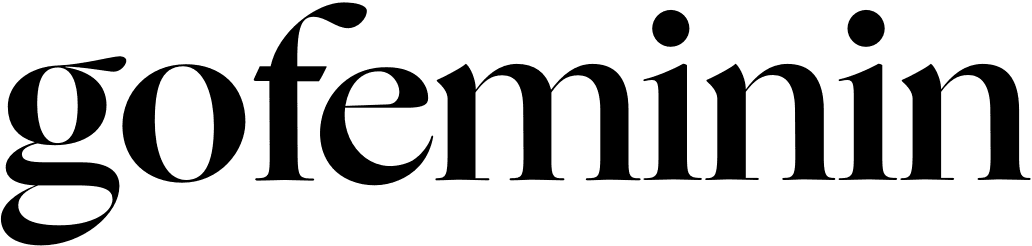Ich bin kürzlich auf einen Instagram-Post aufmerksam geworden, der mir die Augen noch einmal ganz neu geöffnet hat. Und den ich deshalb unbedingt mit euch teilen möchte, weil es euch als Eltern eines schulpflichtigen Kindes direkt oder indirekt betrifft. Und weil ich glaube, dass ganz viele diese Problematik noch nie vorher auf dem Schirm hatten, mich eingeschlossen.
Es geht um diesen Post: „Die unsichtbare Arbeit von Mädchen* im Klassenzimmer„. Er beschreibt, wie Lehrer*innen die Sitzordnung nutzen, um Ruhe in eine Klasse zu bringen. In der Regel, indem sie störende Schüler neben ruhige Schülerinnen setzen. Auch heute noch eine gern genutzte Praxis, die aber vor allem für die ruhige Schülerin Nachteile birgt und alteingesessene Rollenklischees bedient.
Ungleiche Machtverhältnisse
Ich habe die Praxis, dass ein Junge neben ein Mädchen gesetzt wird, damit das Klassenzimmer ruhiger wird, bisher nie hinterfragt. Es erschien mir sogar irgendwie logisch. Was soll die lehrende Person auch anderes tun? Schließlich kann Unterricht nur funktionieren, wenn Ruhe im Klassenzimmer herrscht.
Aber auf wessen Kosten das geschieht, das habe ich jetzt erst verstanden. Und es betrifft besonders die ruhigen Mädchen, die den Störenfried neben sich gesetzt bekommen. Sie erhalten damit nämlich die Aufgabe, für Ruhe zu sorgen.
Mädchen übernehmen neben dem lauten Jungen, wie es der Post beschreibt, ‚emotionale Care-Arbeit‘. Sie sollen durch ihre (vorausgesetzte) ruhige Präsenz dafür sorgen, dass der Junge sich besser benimmt. Damit werden Mädchen indirekt verantwortlich gemacht für das Verhalten des Jungen und auch für die Lernatmosphäre in der gesamten Klasse.
Lies auch: Unsichtbare Überlastung: Wie Mental Load Mamas Alltag dominiert und wie du das änderst
Geschlechterstereotype werden verfestigt
Die Botschaft, die durch diese Sitzordnung (unbewusst) vermittelt wird, lautet: Mädchen müssen sich anpassen, Jungs dürfen laut sein. Das stärkt Rollenklischees, statt Kindern zu zeigen, dass Rücksicht und Selbstkontrolle von allen erwartet wird. Und jeder selbst die Verantwortung für das eigene Verhalten trägt.
Außerdem leidet die Lernatmosphäre für das Kind, dem der störende Mitschüler an die Seite gesetzt wird. Ruhige Kinder sind so ruhig, weil sie das brauchen, um sich zu konzentrieren. Stört ständig der laute Sitznachbar, sinkt ihre eigene Aufmerksamkeit und früher oder später die Leistung, wenn an dieser Konstellation festgehalten wird.
Es kostet das ruhige Kind viel mehr Energie, neben einem lauten, zappeligen oder störenden Schüler zu sitzen als andersrum. Gleichzeitig lernt das laute Kind nicht, sich selbst zu regulieren. Es wird reguliert, durch die Passivität der Sitznachbarin. Sie ist der Puffer zwischen dem Störenfried und der Lehrkraft.
Lies auch: Erziehung: Diese Sätze prägen dein Kind und fördern alte Rollenbilder
Emotionale Belastung
Das ist eine Rolle, die kein Kind übernehmen müssen sollte, denn sie führt zu mehr Stress oder sogar Überforderung. Statt sich im Unterricht mit den eigenen Aufgaben zu beschäftigen und zu lernen, muss das ruhige Kind auch den Sitznachbarn managen. Das kann langfristig das Selbstwertgefühl schwächen.
Zwischen Pragmatismus und Pädagogik: Wie geht’s weiter?
Natürlich ist klar, dass Lehrerinnen und Lehrer unter enormem Druck stehen. Sie haben Lehrpläne, an die sie sich halten müssen und Inhalte, die sie vermitteln müssen, oft in zu wenig Zeit. Wer da für Ruhe im Klassenzimmer sorgen kann, verschafft sich Luft, um überhaupt Unterrichtsinhalte vermitteln zu können. Das ist absolut verständlich.
Trotzdem bleibt die Frage: Wie kann man laute oder störende Schüler(innen) so begleiten, dass nicht andere (häufig Mädchen) für sie „mitverantwortlich“ gemacht werden? Denn genau das ist der Knackpunkt. Wenn immer wieder ruhige Kinder als Puffer eingesetzt werden und es sich dabei mehrheitlich um Mädchen handelt, fördern wir ungewollt alte patriarchale Muster. Mädchen lernen, Rücksicht zu nehmen und Verantwortung für andere zu tragen, während Jungs lernen, dass sie laut sein dürfen. Und beide verpassen Chancen.
Es braucht also Konzepte, die Selbstregulation und Rücksichtnahme fördern: klare Regeln, feste Rituale, gemeinsame Vereinbarungen und konsequentes Einfordern dieser Standards von allen und für alle. So können Lehrkräfte unterrichten, ohne einzelne Kinder zu überlasten.
Mehr Sensibilität für Rollenbilder
Das eigentliche Problem ist, dass stillschweigend Verantwortung verschoben wird. Mädchen (oder einfach ruhige Schüler*innen) sollen unbewusst das auffangen, was Schule und Lehrkräfte aus Zeit- und Ressourcenmangel nicht selbst auffangen können. Das ist verständlich, aber langfristig ungerecht und pädagogisch nicht zielführend.
Dass der laute Schüler neben die ruhige Schülerin gesetzt wird, spiegelt aber auch die (oft unbewusste) patriarchale Sichtweise wider. Mädchen sollen ausgleichen, beruhigen, Rücksicht nehmen und Verantwortung tragen und Jungs dürfen einfach sein, selbst wenn sie laut sind. So lernen beide Geschlechter falsche Rollen. Die einen lernen, dass sie sich anpassen müssen, die anderen, dass Rücksicht nicht ihr Problem ist.
Lesetipp: 5 Werte, die jedes Kind lernen muss!
Schule und auch Elternarbeit braucht also mehr Sensibilität für das Thema. Lehrkräfte sollten sich bewusst machen, welche Botschaften ihre Sitzordnungen senden. Eltern sollte hinterfragen, ob sie selbst stereotype Erwartungen an ihr Kind haben. Und Schüler*innen sollten mithilfe von Workshops oder in Klassenrat-Stunden erleben, wie unfair solche Rollenverteilungen sind und was es bedeutet, Verantwortung für das eigene Verhalten zu übernehmen.
So schafft man gegenseitigen Respekt und Platz für Fachwissen, Gleichberechtigung und Selbstverantwortung.
Weitere Themen: