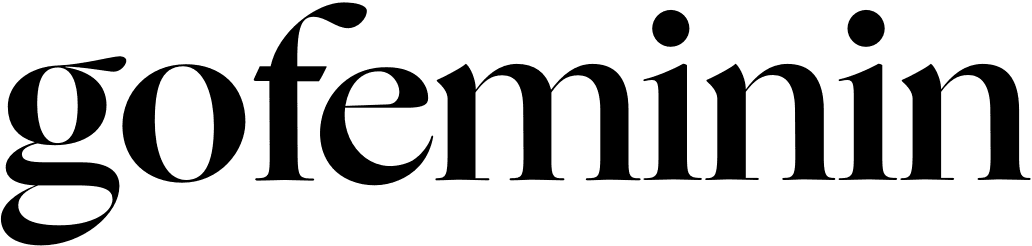Inhaltsverzeichnis
- Labels können praktisch sein!
- Polen: Wo Labels lebensgefährlich sein können
- Ich lable, also bin ich
- Begrifflichkeiten müssen behutsam benutzt werden
Unsere Gastautorin Ricarda Hofmann ist Podcasterin und Comedy-Autorin. Ihr Podcast „Busenfreundin“ ist der reichweitenstärkste LGBTIQ-Podcast für Frauen in Deutschland. Wöchentlich führt sie hier emotionale und unterhaltsame Gespräche mit verschiedenen Persönlichkeiten.
Ihr findet Ricarda auf Instagram. Mehr über Busenfreundin erfahrt ihr auf busenfreundin-magazin.com.
LGBTIQA+: Ein Akronym, das für viele Menschen regelmäßig zu einer unaussprechlichen Hürde wird. Kein Wunder – die Buchstabenkombination „LGBTIQA+“ erinnert im ersten Augenblick an den Buchungscode einer Billig-Fluggesellschaft.
Doch ich kann euch sagen: Würden hier alle Sexualitäten und nicht nur die gängigsten zusammenfinden, sähe es so aus: LSBPATIQACMNSDQOMOS. Volle Punktzahl beim Scrabble!
Aber um niemanden zu überfordern (mich eingeschlossen), nutzen wir hier und heute die kompakte Variante. LGBTIQA+ kommt aus dem Englischen und steht für „Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersexual, Queer and Asexual„. In dieser Buchstabenkombination werden alle gängigen sexuellen Identitäten aufgelistet. Das „+“ am Ende steht für „Allys“ – also für all jene, die die Community unterstützen.
Einige Mitglieder der Community plädieren dafür, LGBTIQA durch das Wort „queer“ zu ersetzen, weil es auch sexuelle Identitäten einschließe, die es nicht in die Buchstabenabfolge geschafft haben. Außerdem verhindere die Begrifflichkeit eine „Schubladisierung“ verschiedener Identitäten.
Doch braucht es nicht manchmal genau diese Kategorien?
Jetzt reinhören: Ricarda spricht bei „Echt & Unzensiert“ über ihr Coming-out
Labels können praktisch sein!
Vorneweg: Jeder Mensch sollte selbst entscheiden, ob ein Etikett an der eigenen Persönlichkeit baumeln sollte oder nicht. Nicht jede*r möchte sich den Stempel „bisexuell„, „schwul“ oder „lesbisch“ auf die Stirn drücken. Wobei das für einige Single-Queers sicherlich super praktisch wäre…
Etikettierung hin oder her – Labels sind hilfreich, weil sie verbinden. So können sich Menschen leichter in gleichgesinnten Communities zusammenschließen und ihre Interessen auf globaler, politischer Ebene formulieren.
Labels helfen insbesondere jungen Menschen dabei, sich in ihrer Entwicklung zu orientieren, Halt zu finden und sich selbst auszudrücken.

Polen: Wo Labels lebensgefährlich sein können
So nützlich Labels für die persönliche Sichtbarkeit sein mögen, so gefährlich können sie auch sein. Labels werden nicht selten von politischen Akteuren benutzt, um für die Gunst von Wähler*innen zu werben. Und dabei geht es oft nicht darum, für gleiche Rechte zu kämpfen.
Dass Selbstbestimmung in einigen Ländern aufgrund von gesellschaftlich-kulturellen oder rechtlichen Gegebenheiten nicht immer möglich ist, wird jüngst in der Debatte um die LGBT-freien Zonen in Polen deutlich.
Bekennt man sich hier zu seiner nicht-heterosexuell orientierten Identität, besteht die Gefahr, Opfer von Diskriminierung, Stigmatisierung, Ausgrenzung, Kriminalisierung und Hassverbrechen zu werden.
Es ist jedem selbst überlassen, die Etikettiermaschine des eigenen Ichs anzuwerfen.
Ich lable, also bin ich
Ist es vor diesem Hintergrund nicht umso wichtiger, sich selbst mit einer Begrifflichkeit zu versehen, um mehr Sichtbarkeit und Akzeptanz der vielfältigen Identitäten auf allen gesellschaftlichen Ebenen zu erreichen?
In meiner Vorstellung ist es utopisch, dass wir irgendwann in einer Welt leben, in der sexuelle und geschlechtliche Kategorien sowie Identitäten nicht mehr wichtig sind. Aber die Betonung liegt auf „noch“. Bis wir dort angekommen sind, braucht es Mittel, die den Menschen dabei helfen, mit nicht-heteronormativen Lebensformen selbstverständlich umzugehen.
Und das sind in diesem konkreten Fall Labels. Hierbei möchte ich nochmal deutlich betonen: Es ist jedem selbst überlassen, die Etikettiermaschine des eigenen Ichs anzuwerfen.
Begrifflichkeiten müssen behutsam benutzt werden
Eine grundsätzliche Frage bleibt dennoch offen: Wie gehen wir mit den eigenen Bezeichnungen um? Oder anschaulicher gesprochen: Heutzutage reicht es vielen Menschen nicht, einfach nur ein Preisschild an einem Supermarktartikel zu sehen.
Viel schöner wäre es doch zu erfahren, woher der Artikel stammt, ob er nachhaltig produziert ist und wie lange er hält (Es sei denn es ist eine Banane, dann ist es auch so sichtbar, aber das führt zu weit…). Indem wir über uns und unser Empfinden sprechen, sorgen wir dafür, dass es für andere selbstverständlicher wird.
Fühlt sich der schwule Mann diskriminiert, wenn er händchenhaltend mit seinem Partner durch die Stadt läuft? Wird das lesbische Paar in seinen Adoptionsbestrebungen mit Heteropaaren gleichbehandelt?

In meinem Podcast „Busenfreundin“ oder im gleichnamigen Magazin setze ich mich mit Fragen wie diesen auseinander und spreche mit Menschen, die sich (in den meisten Fällen) Labels geben. Hier präsentiere ich Menschen, die ihre persönliche LGBTIQ-Geschichte erzählen, mit dem Ziel aufzuklären.
Denn: Um einen Fortschritt in Sachen Sichtbarkeit, Toleranz und Akzeptanz zu verzeichnen, wird meiner Meinung nach kein Weg an den Labels vorbeigehen.
Wie seht ihr das? Sind Labels eurer Meinung nach wichtig? Lasst es uns auf Instagram wissen!