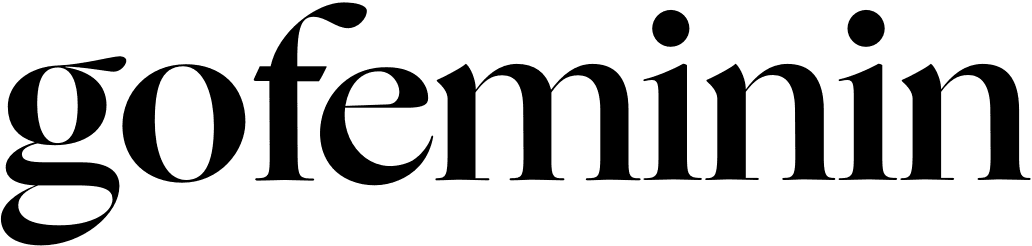Wenn Mädchen in der Pubertät streiten, geht es selten nur um Worte. Freundschaften, Status und Zugehörigkeit hängen oft an einem seidenen Faden. Und genau das macht Konflikte so schmerzhaft. Hinter scheinbar kleinen Kommentaren und Gesten stecken komplexe Dynamiken, die für alle Beteiligten hoch emotional sind.
Lesetipp: Pubertät light: Das brauchen Kinder zwischen 9 und 12 Jahren
Viele Eltern kennen diese Sticheleien, die Mädchen im Teenageralter austeilen und die oft viel tiefer gehen als ein offener Schlagabtausch von Jungs. Warum passiert das? Warum sind Teenagermädchen manchmal so gemein zueinander, besonders zu denen, die ihnen doch eigentlich nahestehen?
Warum verletzen sich Mädchen in der Pubertät gegenseitig?
Was von außen wie pure Gemeinheit aussieht, ist oft Ausdruck innerer Unsicherheit. Die Pubertät ist eine Phase massiver Umbrüche: Körperlich, hormonell, emotional. Mädchen müssen plötzlich mit neuen Erwartungen, Rollenbildern und Selbstzweifeln umgehen. Freundschaften werden in dieser Zeit zum wichtigsten sozialen Anker, aber auch zum emotionalen Minenfeld.
Die Entwicklungspsychologie spricht von der „sozialen Reifung“: Jugendliche suchen in der Gruppe Halt, Orientierung und Zugehörigkeit. Gleichzeitig ist ihr Selbstwert noch stark durch äußere Rückmeldung definiert. Das bedeutet: Wer sich selbst nicht sicher fühlt, versucht sich oft auf Kosten anderer besser zu fühlen. Leider sind es gerade enge Freundinnen, die in dieser Dynamik schnell zur Zielscheibe werden.
Ein Beispiel, das vielen von euch eventuell bekannt ist: Wenn ein Mädchen Angst hat, selbst ausgeschlossen zu werden, kann es sein, dass sie andere ausschließt, um ihre Position zu sichern. Das passiert oft nicht bewusst oder aus Bosheit, sondern aus der Angst, selbst nicht dazuzugehören.
Auch lesen: So wichtig ist Lob in der Pubertät – aber viele Eltern machen es komplett falsch
Warum ist das „gemein sein“ bei Mädchen oft subtiler, aber nicht weniger verletzend?
Mädchen greifen seltener zu körperlicher Gewalt, dafür häufiger zu manipulativer Gewalt, der sogenannten ‚relational aggression‚. Das heißt, sie grenzen aus, tuscheln, lästern über andere oder die beste Freundin wird plötzlich ignoriert, ohne eine Erklärung.
Psycholog*innen wie Prof. Dr. Lisa Damour beschreiben dieses Verhalten als „sozialstrategisch“. Mädchen wachsen auch heute noch oft mit der Vorstellung auf, harmonisch, nett und angepasst zu sein. Einen Konflikt oder ein Problem offen anzusprechen, widerspricht für viele diesem Bild. Um sich dennoch durchzusetzen oder Macht auszuüben, greifen sie zu anderen, subtileren Mitteln.
Diese Art der Auseinandersetzung ist deshalb nicht weniger schädlich. Das Gegenteil ist sogar der Fall. Sie ist schwerer zu erkennen, schwerer zu greifen und hinterlässt tiefe emotionale Spuren. Vor allem, weil sie oft von Personen kommt, denen man besonders vertraut hat.
Wie viel Einfluss haben soziale Medien?
Instagram, TikTok & Co. sind längst Teil des sozialen Alltags von Teenagern. Likes, Followerzahlen und Story-Reaktionen werden zur Währung für sie. Wer dazugehört, wird gesehen, wer nicht, existiert (gefühlt) nicht.
Mädchen vergleichen sich hier nicht nur ständig mit Influencerinnen, sondern besonders mit ihren Freundinnen. Wer postet was mit wem? Wer kommentiert wessen Bild? Wer wird nicht markiert? Dieses ständige Vergleichen und Werten verstärkt das Gefühl, in ständiger Konkurrenz zu stehen, auch zu engen Freundinnen.
Besonders problematisch wird es, wenn Konflikte digital weitergeführt werden: durch passiv-aggressive Sprüche, gelöschte Chats oder unkommentierte „Entfreundungen“. Und diese digitalen Gemeinheiten lassen sich nicht einfach abschütteln.
Lesetipp: Cybermobbing: So schützt du dein Kind vor der Gefahr
Was können Eltern tun, wenn ihre Tochter zur Zielscheibe wird?
Das Wichtigste ist wohl Dasein, Zuhören und das Problem ernst nehmen. Auch wenn das Drama von außen banal erscheint, für dein Kind ist es gerade das Wichtigste der Welt. Urteile also nicht vorschnell oder versuche, das Problem direkt für deine Tochter zu lösen. Frag lieber nach, was genau passiert ist, wie sich dein Kind fühlt und was es von dir braucht.
Lies auch: Selbstzweifel in der Pubertät: Diese Worte geben deinem Kind Halt
Fühlt sich dein Kind ernst genommen und gut aufgehoben, kann es beginnen, sich mit dem Problem und den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. Und dann kann man gemeinsam überlegen: Wie kann ich mich schützen, ohne selbst gemein zu werden?
Achtung: Geht es um Mobbing, solltet ihr überlegen, ob weitere, offizielle Schritte erforderlich sind. Aktuell haben wir zwar Sommerferien, aber zieht sich der Konflikt darüber hinaus in die Schulzeit, kann es sinnvoll sein, die Schule zu informieren, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Aber Vorsicht: Handle nicht hinter dem Rücken deines Kindes. Lass es über jeden Schritt Bescheid wissen.
Und was, wenn die eigene Tochter diejenige ist, die andere verletzt?
Auch das passiert und ist für Eltern oft besonders schwer auszuhalten. Aber anstatt zu schimpfen oder dem Kind Schuldgefühle zu machen, hilft ein offenes Gespräch. Warum hast du das gemacht? Was wolltest du damit erreichen? Wie würdest du dich fühlen, wenn es dir passiert wäre?
Wichtig ist, nicht das Kind, sondern das Verhalten zu kritisieren. Und deutlich zu machen: Du bist okay, aber was du da gesagt oder getan hast, war nicht in Ordnung. Mädchen brauchen in dieser Phase Orientierung und Klarheit und keine Abwertung.
Sehr oft steckt hinter dem gemeinen Verhalten ein Problem oder ein ungelöstes Gefühl: Eifersucht, Wut, Angst, Überforderung. Wenn wir diesen Gefühlen Raum geben, kann sich oft auch das Verhalten verändern.
Gemeinheit ist oft ein Schrei nach Verbindung
Teenagermädchen sind nicht „zickig“. Sie sind verletzlich, verunsichert und auf der Suche nach sich selbst. Gemeinheiten sind in vielen Fällen ein Ausdruck dieser inneren Kämpfe und keine grundsätzliche Boshaftigkeit.
Das bedeutet nicht, dass wir alles hinnehmen oder schönreden müssen. Aber es hilft, genauer hinzuschauen: Was steckt dahinter? Was braucht mein Kind? Und wie kann ich es begleiten?
Erwachsen werden ist kein gerader Weg und schon gar kein einfacher. Aber wenn wir unsere Kinder in dieser lauten, widersprüchlichen Zeit mit offenem Herzen begleiten, haben sie die Chance, nicht nur klug und stark zu werden, sondern auch empathisch, reflektiert und beziehungsfähig.
Weitere Themen:
- Selbstbewusstsein statt Anpassung: Diese Tipps machen Mädchen stark
- Freundin heute, Feindin morgen: Warum Mädchen in der Pubertät so verletzend sein können
- Warum ausschließlich Papas ihre Kinder zum Spielplatz begleiten sollten
- Studien zeigen: Bestimmte Väter machen Kinder empathischer und selbstbewusster