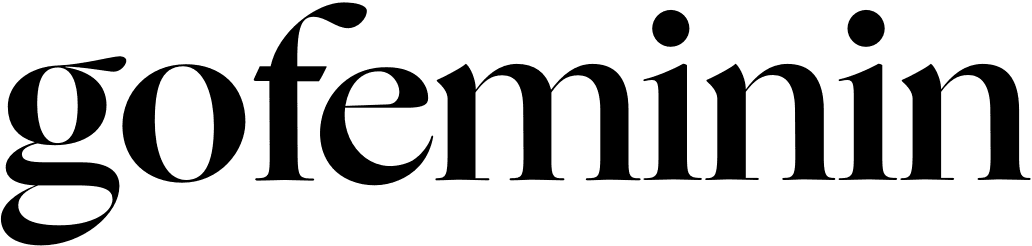Was ist strategische Inkompetenz bei Kindern?
Strategische Inkompetenz, oder auch bewusstes Nichtkönnen, bezeichnet Situationen, in denen ein Kind so tut, als könne es eine Aufgabe nicht bewältigen. Faktisch wäre es aber in der Lage dazu.
Es tut unfähig, um die Aufgabe zu vermeiden und hofft darauf, dass jemand anderes sie übernimmt. Wichtig: Das ist nicht dasselbe wie echtes Nichtverstehen, mangelnde Fähigkeiten oder Überforderung. Strategische Inkompetenz ist eine Verhaltensstrategie.
Lies auch: Wie du verhinderst, dass dein Kind zum People Pleaser wird
Ab wann können Kinder strategische Inkompetenz einsetzen?
Damit ein Mensch sich bewusst ‚dumm stellen‘ kann, um eine ungeliebte Aufgabe zu vermeiden, muss er eine gewisse kognitive Reife haben. Bei Kindern hängt es deshalb stark von ihrer Entwicklung in Bezug auf Selbstbewusstsein, kognitive Fähigkeiten, Motivation und das soziale Umfeld ab.
Kinder im Vorschulalter (3 – 6 Jahre) lernen erst, Verantwortung zu übernehmen. Ihre motorischen und kognitiven Fähigkeiten entwickeln sich zwar rasend schnell, in diesem Alter sind sie aber noch stark abhängig von Anleitung und Rückmeldung.
Ab dem Grundschulalter (6 – 10 Jahre) sind Kinder zunehmend fähig, Aufgaben selbstständig zu übernehmen. Gleichzeit beginnen sie zu verstehen, dass andere Menschen gewisse Erwartungen haben. Sie merken, wenn jemand höhere Erwartungen an sie hat als sie selbst.
Ungefähr ab der frühen Pubertät (ab 9 oder 10 Jahren) wissen Kinder schon ziemlich genau, wer sie sind. Sie haben ein gewisses Rollenverständnis, eine gute Selbstwahrnehmung und wissen sich in verschiedenen sozialen Situationen anzupassen. Ab diesem Alter können Kinder bewusst kalkulieren, welche Reaktionen sie hervorrufen und beginnen, mit Ausreden, Verzögerung oder bewusster Unfähigkeit zu experimentieren.
Das heißt, Kinder setzen strategische Inkompetenz nicht vor dem späten Grundschulalter wirklich als bewusste Strategie ein, aber erste Formen wie Vermeidung oder Ausreden sind durchaus schon vorher möglich.
Woher kommt dieses Verhalten?
Wie so oft gibt es mehrere Faktoren, die dazu führen, dass Kinder (bewusst oder unbewusst) strategische Inkompetenz lernen.
- Erlernte Hilflosigkeit
Erleben Kinder wiederholt, dass ihre Bemühungen nicht anerkannt werden, fehlschlagen oder ignoriert werden, kann sich ein Gefühl der Hilflosigkeit entwickeln. Sie lernen dann, dass es ’sicherer‘ ist, es gar nicht erst zu versuchen, statt einen Fehler zu machen oder zu scheitern. - Belohnung durch Entlastung
Wenn Eltern, Geschwister oder Bezugspersonen Aufgaben übernehmen, sobald ein Kind sagt „Ich kann das nicht“, wird das Kind positiv verstärkt. Es erlebt Entlastung, Anerkennung und Aufmerksamkeit, ohne die Aufgabe selber erledigen zu müssen. Je öfter das vorkommt, um so schneller verfestigt sich diese Strategie beim Kind. - Schutz vor Kritik
Aus Angst, etwas schlecht zu machen oder negative Kritik für etwas zu bekommen, geben Kinder manchmal vor, etwas nicht zu können. Sie glauben, so können sie keinen Fehler machen und schützen sich selbst vor Enttäuschung. - Rollenbilder und Erwartungen
Kinder nehmen sich irgendwann bewusst als Junge oder Mädchen wahr und sind sich auch über so manche Geschlechterrolle im Klaren. Annahmen darüber, was ein Junge oder was ein Mädchen können sollte, können beeinflussen, wie sehr ein Kind glaubt, etwas gut machen zu müssen. Oder im Gegenteil, etwas gar nicht machen zu können. Suggeriert einem also die Geschlechterrolle, dass man etwas sowieso nicht so gut kann, fällt es leichter, genau das als Ausrede zu nutzen. - Persönlichkeit und Temperament
Kinder, die schüchtern, vorsichtig oder auch perfektionistisch sind, neigen eher dazu, Aufgaben zu meiden, bei denen sie sich unsicher fühlen. Auch besonders impulsive Kinder und jene mit geringer Frustrationstoleranz fangen lieber gar nicht erst mit einer Aufgabe an, als mittendrin frustriert aufzugeben.
Auch interessant: Strategische Inkompetenz: Was hilft, wenn sich der Partner absichtlich dumm stellt
Strategien für Eltern und Erziehende
Eigentlich ist die strategische Inkompetenz ein schlauer Move, zumindest für die ausführende Person. So tun, als würde man etwas nicht können und dabei zusehen, dass andere die Aufgabe dann übernehmen, erspart einem in jedem Fall Arbeit. Haben wir alle schon mal gemacht, so ehrlich können wir wohl sein.
Allerdings bringt einen das selten weiter im Leben. Wer immer Fehler vermeidet und nie Dinge tut, die außerhalb der eigenen Komfortzone liegen, der tritt nur auf der Stelle. Außerdem ist es sehr egoistisch, ungeliebte Aufgaben immer abzugeben.
Damit ein Kind sich also gar nicht erst daran gewöhnt, immer andere die unliebsamen Aufgaben machen zu lassen, kann man dem früh entgegenwirken.
Können vs. Nichtkönnen
Bevor man reagiert, sollte man jedoch erst einmal herausfinden, ob das Kind die Aufgabe wirklich nicht kann oder ob es eine Ausrede ist. Am besten fragt man deshalb konkret nach, warum das Kind glaubt, etwas nicht zu können: „Was genau fühlst du, dass du noch nicht kannst?“ Oder, man versucht herauszufinden, ob das Kind eventuell mehr Erklärung oder eine kleine Hilfestellung benötigt: „Was glaubst du, brauchst du, um das zu schaffen?“ So wird schnell klar, ob ein Kind etwas wirklich noch nicht kann oder nur so tut.
Auch interessant: Indirekte Hilferufe: Hinter diesen typischen Kindersätzen steckt oft tiefer Kummer
Entwicklungsstand beachten
Achte zudem darauf, dass Aufgaben zum Entwicklungsstand des Kindes passen. Damit ein Kind sich Dinge zutraut und bereit ist, neues und unbekanntes auszuprobieren, sind Erfolge am Anfang wichtig. Starte deshalb mit überschaubaren Aufgaben und steigere diese langsam.
Fehlerfreundlich sein
Und natürlich darf dein Kind auch mal einen Fehler machen. Die passieren uns allen und gehören einfach zum Leben dazu. Unterstütze dein Kind, aber nimm ihm die Aufgabe nicht ab. Hat dein Kind Zweifel, dass es eine Aufgabe erledigen kann, sprecht vorher über Lösungsmöglichkeiten.
Klärt Erwartungen
Sag deinem Kind, was du erwartest und warum. Erkläre, was es lernen kann, wenn es alleine versucht, die Aufgabe zu meistern. Versuche, keinen Druck aufzubauen.
Feedback
Positives Feedback wirkt oft stärker als Kritik. Erkenne deshalb auch fehlgeschlagene Versuche an. Sei aber auch konsequent, wenn dein Kind die Aufgabe nicht erledigt hat. Nimm sie ihm nicht ab, sondern lass es dasselbe noch einmal versuchen, solange, bis es gelingt.
Lies auch: Gute Erziehung: Wie klare Regeln starke Kinder hervorbringen
Rollenvorbilder
Kinder beobachten sehr genau, wie wir Eltern mit Aufgaben umgehen, welche Aufgaben wir zügig übernehmen und wie wir damit umgehen, wenn wir keine Lust haben oder etwas nicht gelingt. Sehen sie, dass die Eltern Herausforderungen annehmen, statt ihnen auszuweichen oder sie aufzuschieben, vermittelt das, dass es normal und wichtig ist, sich anzustrengen.
Bewusst hinschauen statt vorschnell urteilen
Strategische Inkompetenz bei Kindern ist selten bloß Faulheit. Dahinter stecken meist Ängste, erlernte Muster oder schlicht der Wunsch, unangenehme Aufgaben aus dem Weg zu gehen.
Erkennst du, dass dein Kind wirklich Unterstützung braucht oder geschickt Verantwortung abgibt, kannst du liebevoll, aber klar reagieren. Altersgerechte Aufgaben, transparente Erwartungen und positive Rückmeldung helfen deinem Kind, echte Selbstständigkeit aufzubauen. So wird aus vermeintlichem Nichtskönnen langfristig Kompetenz, die das Selbstvertrauen deines Kindes in sich selbst stärkt.
Weitere Themen: